In einem recht heftigen Regenschauer, geschützt unter einem Sonnendach sitzend, öffnete ich erneut den zukünftigen dritten Band der Alice-Trilogie. Im August des letzten Jahres, da hatte ich einen passenden Schluss für die Geschichte zwischen E., der eigentlich R. ist und A., die eigentlich P. ist, gefunden und war zufrieden damit. Gewiss, glücklich war ich nicht. So ist das mit Schriftstellern, die sich am Leben, nicht am Fiktiven orientieren wollen, das man nach Gusto und Geschmack verändern kann. Aber wer die Realität des irdischen Irrsinns einfangen möchte, darf sich nicht mit halben Wahrheiten abgeben und schon gar nicht aus dem Fiktiven schöpfen. Seufzend muss der Schriftsteller früher oder später feststellen, dass sich das gelebte Leben keinen Deut um den Leser oder die Leserin schert. Dramaturgie ist die erfundene Theatralik eines trostlosen Autors, der alles will, aber nichts bekommt. Solch eine hochtrabende Erklärung zu verstehen, ist äußerst schwierig. Kommen wir deshalb zum Einfachen.
A. meldet sich nach einem Jahr bei E. Ja, in einem Roman sind Zeitabstände von keinerlei Bedeutung, da reicht ein neues Kapitel, um dem Leser oder der Leserin anzuzeigen, dass es einen zeitlichen Bruch gibt. Ein Jahr ist es also her. Viel mag da geschehen sein. Und auch wieder nicht. Je nachdem. Jedenfalls gibt es ein gemütliches Treffen, die alte Ordnung, wenn man so will, wird zwischen den beiden wieder hergestellt. E. merkt dabei gleich, dass A. zugänglicher geworden ist. Das hat Gründe, die hier nichts zur Sache tun, aber im Buch sicherlich Erwähnung finden werden. Freilich, die nächste Verabredung sollte wieder drei – oder sind es vier? – Wochen auf sich warten lassen. Ja, so ist das im Sommer, wenn Ferien- und Urlaubszeit jegliche Annäherung aufschieben. Jedenfalls kommt es zum „Date“, wie A. im mondänen Salettel scherzhaft einwirft. E. merkt gleich, dass A. nicht mehr so zugänglich ist, wie noch vor Wochen. Der Grund – dahingehend lasse ich E. grübeln – dürfte eine Verschiebung von As. örtlichem Lebensfokus sein. Oft hat sie darüber nachgedacht, diesmal, weil die Fügung des Schicksal (oder des Autors) es so wollte, machte sie Nägel mit Köpfen. Kurz gesagt, A. wird alsbald für immer aus dem Umfeld von E. verschwinden. E. muss diese Tatsache natürlich erst verdauen, aber A., wohl wissend um die Gefahr von Es. Grübelei, die alte Wunden aufzureißen versteht, betäubt ihn mit blutrotem Wein. Sekt, wirft sie lakonisch ein, habe sie nicht eingekauft.
Brav und folgsam wie E. nun einmal ist, hat er den Wein getrunken und sich damit ins gedankliche Abseits begeben. Natürlich liebäugelt er mit einem Schimmer Hoffnung. Aber in diesem primitiven Wein ist weder Schimmer noch Hoffnung zu finden. Nichtsdestotrotz nimmt er einen Anlauf. A. weiß natürlich längst, was auf sie zukommt und lässt E. folgerichtig ins Leere laufen. Mit einem Stoßseufzer nimmt E. wieder Platz und verliert jede Lust, seinen schweren Kopf weiterhin mit Alkohol zu betäuben. Die Nacht verläuft den Umständen entsprechend freundschaftlich getrennt.
Der Morgen lässt E. viele Seiten ins Tagebuch schreiben (das hat er vom Autor „geerbt“), bis sich A. bei ihm mit einem Morgengruß einstellt. Das gemeinsame Frühstück ist ein recht gesprächiges, auch wenn sich E. wünschte, es würde tiefer gehen. Aber A. hat gar nicht erst die Absicht, in ihrer Psyche hinabzuklettern, sondern ist bereits mit der Planung ihres Tages beschäftigt. Nachdem das Geschirr abgewaschen ist und E. beginnt, sich Gedanken um die Herkunft des Wortes „Wehmut“ zu machen, ist für A. die Zeit des Abschieds gekommen.
Der Abschied verläuft in aller Eile. A. kann es nämlich partout nicht leiden, wenn man diesen zu sehr in die Länge zieht. E. hingegen hätte gerne ein theatralisches Ade haben wollen, weil, so sagt er sich, es das allerletzte Mal sein könne. Aber am Ende entscheidet immer A. und damit wird die Tür und das Kapitel rasch und ohne Aufsehen geschlossen.
Kapitel ist das Ganze wohl nicht. Eher mutet es wie ein Epilog an, der Anstalten macht, in einer gewöhnlichen Banalität abzusaufen. Das ist immer die Crux, wenn einem das wahre Leben vor Augen steht und man sich Geklingel und Geklimper wünscht, aber am Ende nur ein leises Gesäusel bekommt. Das mag für den Leser oder die Leserin unbefriedigend sein, aber wer sich auf das Wunder des Erlebten einlässt, weiß den Hauch des Faktischen zu schätzen.
Freilich, noch ist eine weitere Begegnung zwischen den beiden möglich. Sagt der Autor. Sagt das Schicksal.
Demnach lebt die Hoffnung, dass die Geschichte zwischen A., die eigentlich P. ist und E., der eigentlich R. ist, ihr wohlverdientes Ende findet, das für alle Ewigkeit zwischen zwei Buchdeckeln gebettet werden kann.
Schon bald wird man es lesen können.
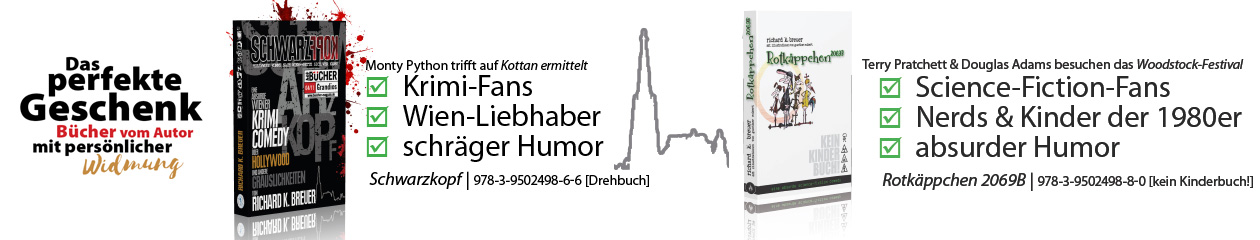

Ein Gedanke zu „Wenn sich die Banalität des Lebens in einem Roman wiederfindet #literatur“