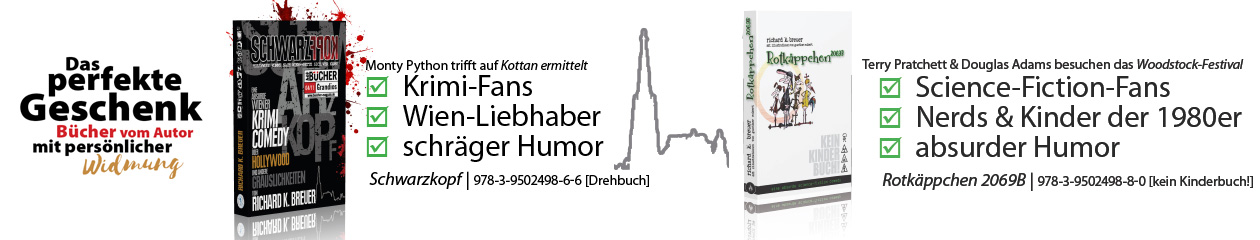Gestern auf die aussagekräftige Infografik von David McCandless gestoßen*), der sich mit den Einnahmen von Musikern auseinandersetzt. Angefangen von selbst publizierten CD-Alben bis hin zu iTunes-Track-Downloads. Um auf das monatliche Existenzminimum von USD 1.160,- oder rund EUR 812,- zu kommen, müsste also unser Musiker rund 150 CD-Alben verkaufen (Verkaufspreis USD 9,90) oder 3.871 CD-Alben, falls er einen „low-end“-Plattenvertrag hat (was auch immer das heißen soll) oder rund 1500 MP3-Downloads eines Musikstückes zum Preis von $ 0,99 bzw. 2000 iTunes-MP3-Downloads erzielen (Apple möchte natürlich einen Anteil vom Verkaufserlös). Falls die Musik gestreamt wird, also vergleichbar einer Ausstrahlung im (digitalen) Radio, dann erhält der Künstler, naja, gerade mal nicht nichts. Je nach Streaming-Dienst müsste der Song zwischen 900.000 Mal und 4 Millionen Mal im Monat gehört werden, um auf die USD 1.160, – zu kommen. Alles klar? Hier gibt es übrigens eine hübsche Aufstellung, welcher Shop wie viel bezahlt.
Ist die Musikbranche mit der Verlagsbranche zu vergleichen? Durchaus. Freilich, Streaming-Dienste gibt es (noch) nicht, können wir also getrost außen vor lassen. Aber sonst zeichnet sich ein ähnliches Bild. Am profitabelsten ist es immer, sein selber produziertes Buch an den Mann oder die Frau zu bringen, ohne dass jemand dazwischen geschaltet wird und die Hand aufhält. Jeder Künstler kann ein Lied davon singen (auch wenn er Schriftsteller ist), dass diese lukrative Einnahme-Quelle alsbald ausgeschöpft ist und Freunde, Bekannte und Ex-Kollegen einen Bogen um einen machen, wenn sie befürchten, in ein Verkaufsgespräch hineingezogen zu werden. Dank des Internets gibt es zwar eine theoretische Möglichkeit beinahe unendlich viele potenziellen Käufer anzusprechen, aber die Realität sieht natürlich nüchtern aus. Oder würden Sie mir ein Buch abkaufen, nur weil Sie durch Zufall auf diesen Eintrag gestoßen sind? Nope.
Niemand kauft gerne die Katze im Sack. Nicht von einem Fremden. Nicht zu einem Preis, der schwerlich nachvollziehbar ist (meine Bücher könnten innen wie außen völliger Mist sein und ich lache mir ins Fäustchen, wenn ein dummer Kerl ne Bestellung abgibt). Gut, dass es Social Media gibt, kann man jetzt einwerfen. Bitte werfen Sie! Aber die sozial virtuelle VerknüpfungsverZUCKERungsmaschine bildet ja nur die Wirklichkeit in einem kleineren, überschaubareren Maßstab ab. Will heißen: Nur weil ich Sie in facebook kenne, heißt es nicht, dass wir uns wirklich kennen. Ein Kommentar auf meiner Pinwand macht uns noch nicht zu guten Freunden. Umgekehrt genauso. Warum sollte ich also von Ihnen etwas kaufen? Warum sollten Sie von mir etwas kaufen? Eben. Gibt ja keinen Grund, oder?
Aber von all diesem virtuellem Firlefanz mal abgesehen, ist die digitale Revolution nicht auch ein Segen? Weil es mir als Verkäufer die Möglichkeit einräumt, unendlich viele Werke bereitzustellen, ohne finanzielle Vorlage leisten zu müssen (man beachte, was Verlage primär groß macht: Ihre Geldmittel, die wiederum zum größten Teil geborgt sind – würde man mir morgen einen Kredit von 10 Millionen Euro einräumen, ich gehe davon aus, dass ich für eine geraume Zeit im Orchester mitspielen würde können; kleiner Seitenhieb: Wie soll ein Kleinverlag mit geringem Budget da jemals mithalten?); durch die Bereitstellung eines theoretisch unendlichen Angebots, gibt es keinen Engpass mehr. Das ist gut. Das ist schlecht. Weil der Mensch zwar ein Herdentier ist, aber innerhalb der Herde dann doch seinen ur-eigenen Platz sucht. Wie dem auch sei, die leichte Bezugsmöglichkeit spricht für das digitale Werk. Und niemand, der dem Kunden sagt „Tut mir Leid, das ist nicht lieferbar!“ oder „Das würde dann wohl drei Wochen dauern, bis es kommt …“ oder „Die Versandkosten würde beinahe so viel ausmachen, wie das Buch kostet!“ – Das sind Argumente, die für die großen Publikumsverlage mit all ihrer logistischen Macht sprechen, nicht für den Kleinverleger oder Eigenverleger, der knapp kalkulieren muss.
Wenn wir von Künstlern sprechen, dann hören wir oft und oft, dass sie eine Fan-Community benötigen. Aha. Gut. Ich denke, das wissen wir alle, oder? Schwieriger ist die Frage zu beantworten, wie man zu einer kommt? Und in einer Epoche der viralen Demenz ist die Trennlinie zwischen informieren/unterhalten und anbiedern/auf die Nerven gehen ziemlich schmal. Und noch mehr, wenn man sich im Social Media Bereich herumtreibt. MySpace sollte ja jedem Musiker (und Künstler) eine Warnung sein – dort konnte man „Bands“ von seiner Pinwand aussperren. Warum? Weil diese nur noch auf sich und ihre Gigs sehr lautmalerisch aufmerksam machten. Am Ende war es nur noch eine Spam-Maschine, die blinkte und brüllte. Entsetzlich. Sollte es einmal ein Künstler oder eine Band geschafft haben, als Spam-Kanone abgetan zu werden, dann ist es besser, man erschafft sich neu. In der virutellen Social-Media-Welt wird man schneller in ne Schublade gesteckt, als man ein Posting beantworten kann.
Im Übrigen will ich jetzt FanBridge ausprobieren (Scheiße, ist das wieder kompliziert). Voerst mal die Ausprobier-Gratis-Version. Es ist eine Seite, auf der jeder Künstler seine Fans „sammeln“ kann. Noch bin ich mir nicht sicher, ob es für mich den Zweck erfüllt. Die Leutchen werden ja immer skeptischer, wenn es darum geht, sich in eine Liste einzutragen. Auch das sollte man in Betracht ziehen.
Wie dem auch sei, ein Künstler, der sich selber vermarktet, braucht Reputation und Aufmerksamkeit wie einen Bissen Brot. Woher soll X. wissen, dass es da einen kreativen Typ gibt, der gute Qualität abliefert? Deshalb sind offizielle Rückmeldungen (jeder kann sie lesen, nicht nur der Künstler) von anderen so wichtig. Ja, um X. zu „beweisen“, dass man „nicht schon wieder einer von den abertausenden Möchtegern-Künstlern“ ist, die allesamt nichts können und nichts sind, braucht es andere, die für ihn in die Bresche springen. Tja. Aber offizielles Feedback bei seinen „Fans“ oder „Freunden“ einzuholen, sie sozusagen einzufordern, fällt unter die Rubrik: „nervig“ und wird vermutlich alsbald gerichtlich untersagt werden.
So bleibt nur in kleinen Dosen auf sich aufmerksam zu machen, um seine Werke und Goodies zu vermarkten. Das Megaphon können wir getrost in der Lade liegen lassen – das Marktschreierische ist vulgär und verträgt sich nicht mit einer fragil musischen Schöpfungskraft. Das Vulgäre (dazu würde auch das Geld zählen) müssen andere für den Künstler erledigen. Und wenn es niemanden gibt, der das für den Künstler tut? Hm. Darüber müsste ich jetzt nachdenken, was es bedeuten könnte. Schätze mal, nichts Gutes.
*) also, gestolpert bin ich nicht, natürlich haben mich Julia Graff und Wiebke Wiechell in einem Posting der facebook-Gruppe Onliner in Verlagen darauf gebracht!