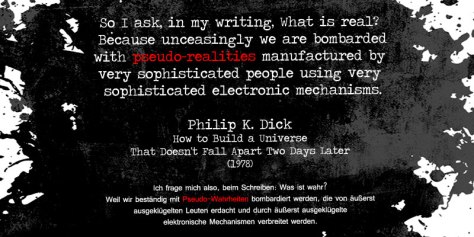
Seltsam, dass mir gestern Abend wieder einmal dieses unangenehme Thema zu Herzen ging. Hin und wieder – zu meist nach einem weiteren Anschlag in Europa oder den Vereinigten Staaten – bemerke ich, wie Medienkonsumenten publizierte Bilder und Videoclips des Ereignisses für bare Münzen nehmen. Sie sind der festen Überzeugung, etwas Authentisches, Echtes, Reales gesehen und gehört zu haben. Woher Sie den Unterschied kennen, zwischen Echtem und Unechtem, bleibt schleierhaft. Niemand, der für gewöhnlich solch traumatische Szenen mit eigenen Augen gesehen, mit seinem eigenen Körper erspürt hat. Würde man ihnen Ausschnitte aus dem Film Blair Witch Project zeigen, würden sie überhaupt erkennen können, dass es sich bei den gezeigten Bildern nur um die low budget Produktion eines Filmstudios handelte?
Der kritiklose Bürger akzeptiert das ihm Gesagte, das ihm Gezeigte. Er hinterfragt nicht. Er nimmt es at face value, weist skeptische Einwände zurück und schlägt Widersprüche in den Wind. Woher kommt diese Leichtgläubigkeit? Erinnert all das nicht an Hans Christian Andersens Märchen Des Kaisers neue Kleider? Wenn ›alle‹ das prachtvolle Kleid des Kaisers sehen, dann muss es doch existent sein, nicht wahr? Oder möchten Sie am Ende behaupten, der Kaiser würde sich tatsächlich nackt dem Volke zeigen? Diese Verschwörungstheorie ist grotesk, geradezu lächerlich. Wir sind demnach in einer Epoche angelangt, in dem die Mehrzahl der Bürger der westlichen Gesellschaft nicht mehr zwischen Echtem und Unechtem unterscheiden wollen. Zukünftige Generationen werden deshalb in eine Welt geboren, die sich – medial betrachtet – künstlich anfühlt. Junge Menschen werden keinen Unterschied mehr machen können, zwischen verordneten und erlebten Gefühlsausbrüchen. Diese Bilder, wird ihnen eindringlich gesagt, sollen Trauer und Mitleid auslösen – und jene Entsetzen und Angst. Mit jeder medialen Berichterstattung über ein weiteres ›traumatisches‹ Ereignis werden die jungen Menschen konditioniert, sozusagen wie der Pawlowsche Hund, abgerichtet. Auf ein bestimmtes in Szene gesetztes filmisches Konstrukt hin – für gewöhnlich sind die Bilder verwackelt, unscharf und von kurzer Dauer – soll der Bürger jeglichen kritischen Gedanken fallen lassen und den Behörden uneingeschränkte Machtbefugnisse zugestehen; nebenbei darf er in Trauer und Agonie die Opfer beweinen, sich mit ihnen solidarisieren, aber niemals dürfe er auch nur daran denken, über den medial-behördlichen Tellerrand zu sehen.
Noch hat der aufgeklärte skeptische Bürger die Möglichkeit, sich mit der Faktenlage vergangener und gegenwärtiger Events vertraut zu machen. Im Web kann jeder eine Vielzahl an Zeugenaussagen finden – seien sie Opfer, seien sie Helfer, seien sie zufällige Bystanders – mal mit, mal ohne Kamera. Man ist erstaunt, was man da zu hören – und vor allem nicht zu hören – bekommt. Beispielsweise sei an dieser Stelle das einstündige Interview einer jungen und hübschen Australierin erwähnt, die im Pariser Bataclan Event mit einer AK 47 in den Allerwertesten geschossen wurde. Eine Woche war gerade einmal vergangen, da sitzt sie bereits strahlend im Studio und lächelt verschämt über ihre Verwundung. Wahrlich, könnte man zur Ansicht gelangen, vielleicht sollte jeder solch eine traumatische Prüfung am eigenen Leib erfahren, um gestärkt und optimistisch in die Zukunft blicken zu können.
Wenn wir uns mit echtem Leid, echten Verwundungen, echten Menschen, echten Kämpfen, echten Kugeln, echten Todesfällen, echten Verlusten auseinandersetzen, bekommen wir einen ganz anderen Eindruck. Gefühle können weder die Beteiligten noch die Unbeteiligten aus dem Nichts erschaffen. Der Mensch erkennt im Gesicht, in der Haltung, in der Aura seines Gegenübers wahre Trauer, wahren Schmerz, wahres Leid, wahren Schock. Noch sind wir nicht gänzlich abgestumpft, noch sind wir empathisch genug, um zwischen Schauspielerei und echtem Leben zu unterscheiden. Aber je öfter wir der Schauspielerei im echten Leben ausgesetzt sind, umso öfter verschwimmen auch für uns die Grenzen. Deshalb ist es wichtig, wirklich wichtig, dass wir uns mit dem Authentischen befassen – so unangenehm und abstoßend es auch sein mag. Es führt kein Weg vorbei, leider. Weil Behörden und Medien alles daransetzen, und ich meine wirklich alles, um Sie und mich in einer Illusionsblase gefangen zu halten. Ein gutes Gegenmittel gegen diese Einlullung ist beispielsweise die gut gestaltete interaktive Webseite über das Attentat auf dem Oktoberfest von 1980 des Bayrischen Rundfunks. Leider sind einige der Videos nicht mehr abspielbar, trotzdem geben all die Clips, Bilder, Interviews und Dokumente einen guten Eindruck, was geschieht, wenn das Unvorstellbare blutige, sehr blutige Realität wird. Die Folgen sind Chaos, Ungläubigkeit, Wahnsinn, Schock, Apathie, Verzweiflung, Hysterie, Scham, Angst, Furcht, Leere, Schmerz, Hilflosigkeit, Stress, Ungewissheit, Ahnungslosigkeit, Ratlosigkeit, Ruhelosigkeit, Sinnestaumel, Gehörsturz, Taubheitsgefühle in Glieder und Seele, Kopflosigkeit und vieles mehr. Mit Sicherheit ist allen Beteiligten – seien sie Opfer oder Zeugen – das so einschneidende Erlebnis im Gesicht, in den Augen, in der Haltung abzulesen; wir spüren es (noch) instinktiv.
Gut. Kommen wir nun zum Punkt. Ich zitiere hier Stimmen, die wissen, was es heißt, wenn Menschen in einen blutigen Konflikt geraten und wie es ihnen dabei ergangen ist.
xxx
»Es gibt kein Ding wie ›sich an den Kampf gewöhnen‹ … Jeder Moment eines Kampfes verursacht eine so große Belastung, dass Männer – in Relation von Intensität und Dauer – zusammenbrechen. Psychische Verletzungen sind im Kriegsfall genauso unvermeidlich wie Schuss- und Splitterwunden …« [meine Übersetzung:] There is no such things as ‚getting used to combat‘ … Each moment of combat imposes a strain so great that men will break down in direct relation to the intensity and duration of their exposure … psychiatric casualities are as inevitable as gunshot and shrapnel wounds in warfare … S. 329, The Face of Battle, John Keegan
xxx
» … ist fünf Minuten einer Schlacht verrichten die Organe im Körper des Soldaten die Arbeit von 24 Stunden. Bean, Australiens offizieller Historiker, beobachtete dass ›die Überlebenden, auch noch nach einem Tag Ruhe, ausgesehen haben, als würden sie in der Hölle gewesen sein. So gut wie ohne Ausnahme sah jeder Mann ausgezehrt und todmüde aus und wirkte so benommen, dass man meinte, die Männer würden schlafwandeln und ihre Augen waren glasig und leer. … Sie waren wie Jungs, die nach einer langen Krankheit ihr Bett verließen.« [meine Übersetzung:] … in five minutes of battle, the physical organs performed the work of twenty-four hours. Bean, Australia’s official historian, observed that »the survivors, even after a day’s rest, looked like men who had been in hell. Almost without exception, each man look drawn and haggard and so dazed that the men appeared to be walking in a dream and their eyes looked glassy and starey. … They were like boys emerging from a long illness« S. 186f., Death’s Men: Soldiers of the Great War, Denis Winter
xxx
»Ich liege wie versteinert. Jeder Pulsschlag schwemmt eine neue Welle Todesangst in meine vom Übermaß gereizten Sinne. Ich habe einmal Dantes ›Divina Commedia‹ gelesen. Wie konnte er das Grauen der tiefsten Hölle beschreiben, wenn er dies hier nie erlebte?! [S. 45f.] Dem Bordmechaniker muß das zerschossene Bein heute doch amputiert werden. Er war die ganze Nacht vor Schmerzen nicht mehr recht bei Sinnen und wollte immerzu aufstehen. Sie haben ihn eben aus dem Operationssaal wieder hergebracht. Er liegt mit offenen Augen in dem Bett drüben an der Wand und spricht kein Wort. Ich spüre, wie er sich innerlich quält. Ich würde ihm gern helfen, aber welche Trostworte nützen in einer solchen Lage? [S.35] Drüben an der Wand liegt einer mit einem schweren Bauchschuß. Er stirbt langsam und ich muß immer wieder zu ihm hinschauen. Mit großen, angsterfüllten Augen schaut er immerzu in der Runde umher, fassungslos. Er kann nicht begreifen, daß er nun sterben soll. Sein stummer Blick scheint uns alle zu fragen, was seine Schuld wohl sei, daß es gerade mit ihm jetzt zu Ende geht. Er ist zu einem lebenden Skelett abgemagert; aber was die Schwester ihm auch zu essen reicht, er würgt und bricht es wieder heraus. Einmal sehe ich, wie er die Hand der Schwester ergreift und fest umklammert hält. Mit seinem todtraurigen Blick fleht er sie wortlos an, ihm doch zu helfen, daß er nicht sterben müsse. Aber es gibt ja keine Hilfe mehr.« S. 47f., Besiegt und Befreit, Gert Naumann
xxx
»Im Kasemattblock verursacht der Durchschlag einen gewaltigen Luftstoß, der die Türen aufreißt und alles durcheinanderwirbelt. Da gleichzeitig die Lampen verlöschen, entsteht eine heillose Verwirrung. Flüche, Schreie, Hilferufe gellen durch die Finsternis, Taschenlampen zucken auf, jemand schreit fortwährend: „Sanität! Sanität!“ Tragbahren werden vorbeigeschleppt, die ratlos Umherstehenden kommen erst zur Besinnung, als einer den Einfall hat, die Alarmglocke zu läuten. Der Drill ist so groß, daß dieses Signal das Chaos überwindet … Nun flammt das Licht wieder auf. Aus dem Verbindungstunnel zum Batteriegang quillt schwarzer Rauch, auf dem Boden liegen ohnmächtig gewordene Kameraden. Trappelnde, schleifende Schritte sind zu hören, Sanitäter mit Rauchmasken kommen aus dem verqualmten Loch. Was sie auf ihren Bahren daherschleppen, sind formlose, verbrannte Massen. Als letzten bringen sie einen, dem Kopf und Rumpf völlig plattgequetscht sind. Sie sagen, es sei Valentiner … Während dieser schrecklichen Minuten sitze ich auf den Stufen der Eisentreppe, die zur Flankierbatterie führt. Dorthin hat es mich geworfen. Es ist schwierig, sich später über den Hergang solcher Geschehnisse genaue Rechenschaft abzulegen. Der betäubende Schlag, die Finsternis, das Durcheinander erfolgten zu rasch, um tiefer ins Bewußtsein zu dringen.« S. 86f., Sperrfort Rocca Alta, Luis Trenker
xxx
»Und während wir für gewöhnlich hören konnten, wenn eine Granate angeflogen kam und wir in Deckung gingen, gab es bei einem Gewehrschuss keine Vorwarnung. Und obwohl wir mit der Zeit lernten, dass wir uns vor einer Gewehrkugel nicht zu ducken bräuchten, weil, wenn man den Schuss einmal gehört hatte, musste die Kugel einen bereits verfehlt haben, so machte uns Gewehrfeuer weit nervöser.« [meine Übersetzung:] And whereas we could usually hear a shell approaching, and take some sort of cover, the rifle-bullet gave no warning. So, though we learned not to duck a rifle-bullet because, once heard, it must have missed, it gave us a worse feeling of danger. S. 83, Goodbye to All That, Robert Graves.
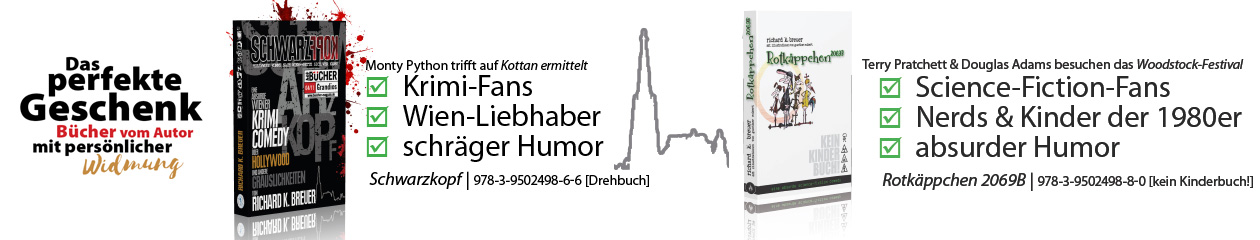
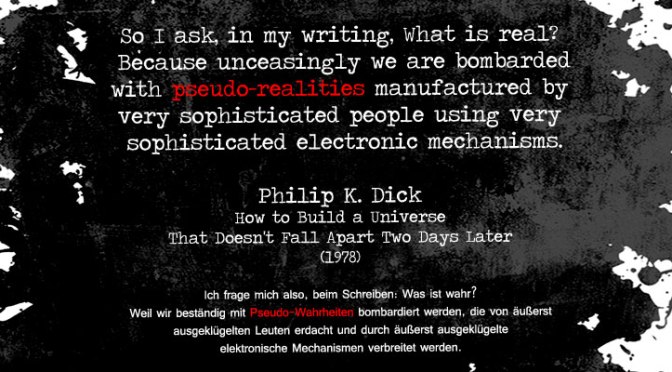
2 Kommentare zu „Das Trauma eines Anschlags oder Die merkwürdige Gefühllosigkeit des Betrachters“